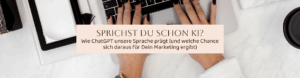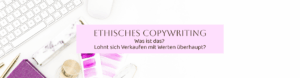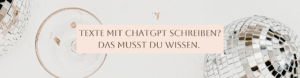In meinem letzten Beitrag habe ich Dir Informationen zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zusammengestellt. Dort erfährst Du, was es damit auf sich hat, ob das Gesetz Dich einschließt und auch, warum mir dieses Thema besonders am Herzen liegt.
Vielleicht fällst Du unter das Gesetz. Vielleicht bist Du aber auch wie ich und möchtest möglichst inklusiv arbeiten – unabhängig davon, ob es ein Gesetz vorschreibt oder nicht.
Der folgende Leitfaden bezieht sich primär auf die Textgestaltung Deiner Website. Am Ende verrate ich Dir noch einige Tipps speziell für Deine Social Media Posts, die Dir so sicher nicht bewusst waren.
Das liest du im Beitrag
1. Was sind barrierefreie Texte?
Die Initiative Barrierefreiheit definiert barrierefreie Texte als “so gestaltet, dass sie für möglichst viele Menschen leicht verständlich und zugänglich sind. Das bedeutet, sie sind klar, prägnant und verwenden einfache Sprache. Zudem sind sie visuell ansprechend und gut strukturiert. Ziel ist es, dass keine Gruppe ausgeschlossen wird – insbesondere Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, Sehbehinderungen oder Lernschwierigkeiten.”
Vielleicht weißt Du von mir, dass ich eine Zeit lang auch in der Türkei gelebt habe. Ich kann mich also gut in die Situation von Nicht-Muttersprachler*innen hineinversetzen.
Mit dieser Erfahrung kann ich Dir sagen:
Barrierefreiheit stärken betrifft uns alle. Es geht hier nicht “nur” um Menschen mit Behinderungen, sondern eben auch um Nicht-Muttersprachler*innen, ältere Personen und Menschen mit temporären Einschränkungen.
Barrierefreie Texte haben wirklich viele Vorteile:
2. Vorteile barrierefreier Texte für Dein Unternehmen
Barrierefreie Texte bieten allen Besuchern Deiner Seite eine bessere Nutzererfahrung, auch User-Experience (UX) genannt.
Indem Du klarer und verständlicher kommunizierst als bisher, steigern barrierefreie Texte Deine Reichweite und reduzieren Missverständnisse.
Darüber hinaus werden Texte, die auf Barrierefreiheit achten, von Suchmaschinen wie Google besser indexiert. Das heißt, Du wirst über google schneller gefunden (Stichwort: SEO oder Suchmaschinenoptimierung), denn die Einschätzung einer guten Lesbarkeit zahlt als Qualitätsmerkmal auf Deine Seite ein.
Nicht zuletzt zahlt barrierefreies Schreiben auf Dein Markenimage als Personenmarke, Unternehmen oder als Arbeitgeber ein. Inklusives Handeln demonstriert Haltung und zeigt soziales Verantwortungsbewusstsein. Das ist attraktiv.
3. Barrierefreie Texte auf Deiner Website schreiben
Barrierefreies Schreiben = gutes Schreiben.
Viele der Regeln und Merkmale für gute Texte gleichen denen für barrierefreie Texte. Und sie sind auch der Grund dafür, warum gerade deshalb Deine Texte in Zukunft NICHT langweilig klingen.
In einer kurzen Checkliste für das Schreiben barrierefreier und guter Texte fasse ich Dir am Ende noch einmal alle folgenden zusammen.
3.1 Schreibe in einfacher Sprache
Das Barrierefreiheits-Stärkungsgesetz fordert von Unternehmen künftig ausdrücklich die Nutzung einer einfachen Sprache.
Behörden hingegen sind verpflichtet, auf Ihren Websites in Leichter Sprache zu kommunizieren. Leichte Sprache folgt klaren Regeln.
Für die künftig von Unternehmen geforderte Einfache Sprache gibt es keine klare Regulierung. Das bedeutet für uns Schreibende etwas mehr Spielraum und Kreativität.
Einfache Sprache zu nutzen ist einer der ersten Punkte, die ein Texter lernt. Ich verrate Dir hier die Must Dos für gute Texte in einfacher Sprache:
- Werde so konkret wie möglich. Sprich beispielsweise nicht nur von einem Haus, sondern benenne das gemeinte Gebäude genau. Ist es eine Stadtvilla, ein Mehrfamilienhaus, ein Bungalow oder eine Holzhütte? Oder: Es gibt so viele Grüntöne, z. B. Apfel- oder Limettengrün, Neon-, Moos- oder Smaragdgrün – nutze das für Deine Texte. Das macht sie verständlicher und gleichzeitig viel interessanter
- Vermeide Metaphern und Stilmittel wie Ironie, um Missverständnissen vorzubeugen. Nutzt Du Metaphern oder Vergleiche, dann ergänze sie um eine Erklärung.
- Ein Beispiel: Ich wurde vor ein paar Tagen gebeten, ein Statement für eine TV-Ausstrahlung von mir aufnehmen zu lassen. U.a. erklärte ich in meiner Absage: “
Ich wirke vor der Kamera so natürlich wie eine Kuh im Affenwald. Jeder sieht, das das nicht passt und ich mich unwohl fühle.
- ”
- Trenne lange zusammengesetzte Wörter mit Bindestrichen. So werden sie von Deinen Leser*innen leichter erfasst.
Teste es selbst:
Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
oder
Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft
hat es wirklich so in unserem Wortschatz gegeben.
Heute würde man diese Wörter eher so schreiben:
Rindfleisch-Etikettierungs-überwachungsaufgaben-Übertragungsgesetz und Donau-Dampfschifffahrts-Elektrizitäten-Hauptbetriebswerkbau-Unterbeamtengesellschaft.
Aber ich gebe zu, selbst mit Bindestrich zählt das nicht unbedingt zu “einfacher” Sprache.
- Verzichte auf aufgeblasene Wörter, Fachbegriffe, Fremdwörter, Abkürzungen und Mode-BlaBla.
Spreche als Webdesigner zum Beispiel nicht von Usability-Engagement maximieren sondern von „Benutzerfreundlichkeit verbessern“ oder „die Bedienbarkeit steigern”. Sind Fachbegriffe unabdingbar oder für Deine Zielgruppe Alltagssprache (z.B. in einem medizinischen Fachartikel), kannst Du die entsprechenden Wörter
- in einem Glossar am Ende auflisten oder
- direkt im Text erklären (z. B. in Klammer dahinter).
Nutze Aktivsätze statt Passivformulierungen. Passiv: „In den Coachings wirst du dabei unterstützt, deine Blockaden zu erkennen und zu überwinden.“ Aktiv: „In den Coaching-Sitzungen erkennst und überwindest Du Deine Blockaden.“
3.2 Streiche Substantivierungen beziehungsweise den Nominalstil
Nominalstil ist das typische Beamtendeutsch. Es ist kompliziert zu lesen und langweilig zugleich.
Ein Beispiel:
Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift hat Konsequenzen in Form von Bestrafung zur Folge!
Verständlicher ist:
Wer diese Vorschrift nicht beachtet, wird bestraft.
Oder kurz:
Wer nicht hören will, muss fühlen.
Tipp: Vermeide Umschreibungen und arbeite immer mehr mit Verben statt mit Substantiven.
So wird beispielsweise aus
- Die Creme sorgt für eine Intensiv-Regeneration der Haut und fördert eine Zell-Reparatur von innen heraus.
durch den Einsatz von Verben eine ansprechende Version:
- Die Creme regeneriert die Haut und repariert die Zellen von innen.
3.3 Setze Eigenschaftswörter nur mit Bedacht ein
Meine Kinder lernen in der Schule immer noch, dass quasi nichts über Adjektive geht. Auch Dir und mir wurde das so beigebracht. Aber an dieser Stelle musst Du umdenken.
Zu viele Adjektive verwässern Deine Botschaft. Das ist wie mit einem Maracujasaft-Schorle. Je mehr Wasser Du dazu gibst, desto weniger bleibt vom eigentlichen Saft. Aber Deine Leser*innen wollen den vollen Geschmack. Sie wollen Klarheit.
Was bedeutet das konkret?
Für manche Dinge gibt es einfach schon passende Worte. Zum Beispiel ist ein großes Unglück das selbe wie eine Tragödie. Und spürst Du auch, wie viel mächtiger der Begriff “Tragödie” ist?
Ein weiteres Beispiel macht es noch deutlicher:
- Überladen: Die intensiv pflegende, feuchtigkeitsspendende, straffende, tiefenwirksame Creme mit einer einzigartigen Formel aus organischen, nachhaltig gewonnenen Pflanzenextrakten und regenerierenden Wirkstoffen sorgt für eine sichtbare Reduktion von Falten, tiefen Linien und Hyperpigmentierung und verleiht der Haut ein jugendlich frisches, gesundes und strahlendes Aussehen.
- Vereinfachte Version: Diese Feuchtigkeitscreme zieht schnell ein und lässt die Haut frisch und strahlend wirken.
Welche der Varianten ist klarer in ihrer Aussage?
3.4 Schreibe in kurzen Sätzen
Laut deutscher Presseagentur verstehen wir Sätze mit maximal 9 Wörtern am besten. Andere Quellen trauen uns bis zu 15 Wörtern pro Satz zu, um ihn zu verstehen.
Die Sätze oben bestehen aus 12 beziehungsweise 14 Wörtern.
Und Du hast sie verstanden.
Richtig?
Liest Du immer noch?
Ich sage Dir, warum:
Lese-Rhythmus.
So lautet der hier versteckte Gold-Tipp.
Wenn alle Sätze ungefähr gleich lang sind, schläft der Leser ein. Deshalb rate ich Dir: Wechsel zwischen kurzen und langen Sätzen. Der Rhythmus ist wie eine Musik, die Deine Leser*innen vorantreibt und ihr Gehirn wach hält.
Zusatztipp: Achte bei Deinen Sätzen auf eine klare Satzstruktur und halte jeweils Subjekt, Prädikat und Objekt zusammen.
3.5 Strukturiere Deine Texte
Plane, was genau Du aussagen willst. Klarheit ist beim Thema Barrierefreiheit das A und O bis hin zum Z.
Verwende Absätze und Zwischenüberschriften. Dadurch gliederst Du den Inhalt. Das vereinfacht es Deinen Lesern. Außerdem lieben Suchmaschinen wie Google Struktur.
Auch innerhalb Deiner Texte. Nutze deshalb Aufzählungen und BulletPoints. Das ist übrigens auch ein Tipp, um zum Beispiel komplizierte Abläufe wunderbar klar darzustellen. Wie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Natürlich spielt auch die gesamte visuelle Gestaltung eine Rolle. Dazu zählen
- gut lesbare Schriftarten
- die Schriftgröße (vermeide z.B. kursiv oder unterstrichen)
- der Farbkontrast
Die 4 Säulen Barrierefreier Websites habe ich Dir in meinem Beitrag zum BFSG zusammengefasst.
Wenn Du mehr zum Thema visuelle Gestaltung wissen möchtest und darüber, was Du bei barrierefreiem Webdesign beachten musst, empfehle ich Dir den Beitrag über barrierefreie WordPress-Websites von Anika Steinert, meine Go-to-Expertin für WordPress-Webdesign und alles Technische.
3.6. Denke an Bildunterschriften
Menschen mit Sehschwächen können Bilder schlechter erfassen. Verwende deshalb Alternativtext, auch Alt-Tags genannt, für Deine Bilder. Screenreader können diese Texte erfassen und vorlesen.
3.7. Optimiere Deine Texte für Screenreader
Screenreader sind eine geniale Entwicklung. Dank ihnen können sich mittlerweile viel mehr Menschen im Netz bewegen.
Für Screenreader ist es wichtig, dass Deine Texte logisch strukturiert und Deine Überschriften als h1, h2, h3 etc. markiert sind. Darüber hinaus solltest Du die Verwendung von Heteronymen vermeiden.
Heteronym ist ein Wort, das auf verschiedene Weise ausgesprochen werden kann. Jede Aussprache für sich hat dann wiederum ihre eigene Bedeutung.
Ein paar Beispiele:
übersetzen /ʔyːbɐˈzɛt͡sən/ → übertragen (z. B. „Ich übersetze den Text ins Englische.“)
übersetzen /ˈyːbɐˌzɛt͡sən/ → hinüberfahren (z. B. „Wir setzen mit der Fähre über.“)
die Montage /mɔntaˈʒə/ → das Zusammensetzen von Bauteilen oder Bildern.
der Montag /ˈmoːntaːk/ → der erste Tag der Woche.
modern /moˈdeːɐ̯n/ → fortschrittlich, zeitgemäß (z. B. „ein modernes Design“)
modern /ˈmɔdɐn/ → verrotten, verwesen (z. B. „das Holz beginnt zu modern“)
Gerade bei Begriffen wie Montage wird schnell aus dem Kontext klar, was gemeint ist. Wenn ich schreibe “Montage sind hart“, weißt Du, dass ich vom Wochentag spreche. Rufe ich “Die Montage ist anstrengend” ist auch sofort klar, was gemeint ist.
Kannst Du nicht auf das Heteronym im Text verzichten, besteht die Möglichkeit, Aussprache-Informationen für Screenreader hinzuzufügen.
Genderst Du? Dann arbeite am besten mit Sternchen. Die werden von Screenreadern am natürlichsten vorgelesen.
Hier mögliche Screenreader für Dich zur Auswahl und zum Testen Deiner Texte:
- Google Talk Back für Android: https://support.google.com/accessibility/
- Apple VoiceOver für iOS: https://support.apple.com/de-de/HT211899
4. Barrierefrei schreiben auf Social Media
Als Unternehmer*innen schreiben wir nicht nur auf unserer Website. Viele von uns nutzen Social Media für ihr Marketing. Wusstest Du aber, dass hier einige Hürden für Deine Follower*innen bestehen können?
4.1. Gefettete oder kursiv geschriebene Zeilen
Vor allem bei LinkedIn fällt es mir sehr häufig auf: Gefettete oder kursiv geschriebene Texte in der Caption (also im Text des Posts). Screenreader erfassen das als Unicode-Zeichen. Sie lesen sie entweder gar nicht oder buchstabieren sie Zeichen für Zeichen. Beides ist unverständlich für den Hörer.
Verwende normale Schrift anstelle von Unicode-Formaten.
4.2. Emojis
Screenreader lesen Emojis als beschreibenden Text vor (z. B. „rotes Herz“). Wenn viele Emojis hintereinander stehen, kann das zu einer nervigen, langen Vorlese-Orgie führen. Manche Emojis haben unerwartete Beschreibungen (z. B. 🏴☠️ = „Schwarze Flagge mit Totenkopf“ statt „Pirat“).
Nutze nie ein Emoji als Ersatz für ein Wort; setze Emojis sparsam und überlegt ein. Im Idealfall setzt Du Emojis außerdem erst ans Ende eines (Ab-)satzes und nicht innerhalb eines Satzes ein.
4.3. Hashtags mit fehlender Großschreibung
Wenn Hashtags nur in Kleinbuchstaben geschrieben werden, lesen Screenreader sie ohne Trennung vor.
- Beispiel: #meinlieblingsbuch → „meinlieblingsbuch“ statt „Mein Lieblingsbuch“.
- Besser: #MeinLieblingsBuch (CamelCase), damit die Wörter richtig erkannt werden.
Schreibe Hashtags in CamelCase.
4.4 Unstrukturierte Texte & fehlende Alternativtexte
Auch für Social Media gilt: Ein langer Fließtext ohne Absätze ist schwer zu erfassen. Und Bilder ohne Alternativtext (Alt-Text) sind für blinde Nutzer nicht zugänglich.
Nutze Alt-Texte für Bilder und strukturiere Deine Posts durch Absätze.
4.5. Sonderzeichen & Symbole
Manche Plattformen erlauben kreative Schriftarten oder Sonderzeichen wie ↯✦☾. Diese können für Screenreader entweder unaussprechbar oder unnötig kompliziert sein.
4.6. Automatische Untertitel & Spracherkennung
Automatische Untertitel (z. B. bei Instagram Reels oder TikTok) sind oft fehlerhaft, besonders bei Dialekten oder Fachbegriffen. Beachte, dass Screenreader Untertitel manchmal nicht direkt erfassen können, wenn sie als eingebrannter Text in Videos erscheinen.
5. Woher weißt Du jetzt, ob Deine Texte barrierefrei sind?
Es ist schwer und wahrscheinlich nahezu unmöglich, wirklich immer 100 % barrierefrei zu schreiben. Versuche auf jeden Fall, die größten Hürden aus Deinen Texten zu streichen.
Hier die versprochenen Checklisten für Deine Website-Texte und Social Media:
Checkliste für Deine Website-Texte
✅Nutze einfache Sprache
✅Streiche Substantivierungen
✅Vorsicht vor Adjektiven
✅Beachte die Satzlänge
✅Achte auf Struktur
✅Setze Bildunterschriften
✅Optimiere für Screenreader
Deine Social-Media-Checkliste
✅Verwende normale Schrift
✅Setze Emojis sparsam und bewusst ein.
✅Hashtags nur im CamelCase.
✅Strukturiere Deine Texte.
✅Nutze Alt-Text für Deine Bilder
✅Verzichte auf Sonderzeichen & -schriften.
✅Beachte Besonderheiten bei Untertiteln.
Du hast die Punkte oben beachtet? Den Screenreader-Test gemacht? Vielleicht auch betroffene Menschen lesen lassen, um Dir direktes Feedback zu holen? Dann bist Du schon ein sehr gutes Stück weiter.
Die Lesbarkeit Deines Textes insgesamt kannst Du außerdem durch Textanalyse-Tools wie z.B. dem Flesch-Reading-Ease-Test überprüfen.
Dieser Test dient als Instrument zur Bewertung der Lesefreundlichkeit Deines Textes. Ermittelt wird ein Zahlenwert, der im Wesentlichen auf zwei Schlüsselfaktoren basiert: der durchschnittlichen Satzlänge (gemessen an der Anzahl der Wörter) und der durchschnittlichen Silbenzahl pro Wort. Je höher Dein Ergebnis ausfällt, desto lesefreundlicher ist Dein Text.
Anbieter wie LanguageTool bieten Dir auf Wunsch neben einer genauen Grammatik- und Rechtschreibprüfung Formulierungsalternativen.
6. Fazit: Barrierefreie Texte schreiben heißt: Gute Texte schreiben
Ich habe es eingangs bereits verraten: Barriere Texte sind gute Texte.
Beide eint, dass sie für viele Menschen zugänglich sind.
Beide geben Dir die Chance, Deine Zielgruppe noch besser zu erreichen.
Barrierefreies Schreiben zwingt Dich, noch präziser und klarer in Deinen Botschaften zu werden. Und genau das macht gute Texte aus.
Du musst Dich also gar nicht einschränken und darfst weiterhin kreativ in Deinen Texten sein (ich bitte Dich sogar darum).
Freue Dich schon mal darüber, dass Du nun noch mehr Menschen mit Deinem Angebot helfen kannst.
Hast Du Fragen zu Deinen Texten oder willst Du Deine Texte schreiben lassen? Melde Dich gerne bei mir.
Weitere Artikel und Informationen zum Thema Barrierefreiheitsstärkungsgesetz findest Du hier:
Das Barrierefreiheitssärkungsgesetz kommt
BFSG (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz)
Bundesfachstelle Barrierefreiheit – Barrierefreiheitsstärkungsgesetz
Barrierefreie Website Pflichten & Fristen | Aktion Mensch